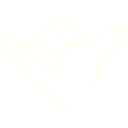Die Schulsozialarbeiter/innen
des Schwalm-Eder-Kreises
Die Schulsozialarbeit, in der Trägerschaft des Starthilfe Ausbildungsverbund Schwalm-Eder e.V., ist ein verlässlicher und professioneller Partner für Schüler, Lehrer und Eltern an 20 Schulen im Schwalm-Eder-Kreis. Sie ist Teil der Jugendhilfe und ein Bindeglied zwischen den verschiedensten Akteuren, Institutionen und Gremien. Die Vernetzung innerhalb und außerhalb der Schule, mit Jugendpflegen anderen Fachdiensten, Seelsorgern und Bildungsträgern leistet einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Lern- und Lebensumfeldes der Schüler.
Arbeitsschwerpunkte
Zu den vielfältigen Aufgaben gehören präventiv ausgerichtete sozialpädagogische Bildungsangebote in Gruppen und im Klassenverband. Sie unterstützen die individuellen Stärken und erweitern die sozialen Kompetenzen der Schüler.
Ein weiterer Schwerpunkt der Schulsozialarbeit besteht in der Krisenintervention sowie in der Beratung und Begleitung von Schülern, Eltern und Lehrern.
Bei Bedarf werden weitere Fachstellen (Beratungsstellen, Schulpsychologischer Dienst, Jugendamt etc.) mit einbezogen.
Unsere Angebote
- Orientierung, Hilfestellungen und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler
- Klärung von Hilfebedarfen
- Vermittlung an Fachdienste
- Förderung der sozialen Kompetenzen
- Offene Sprechstunden
- Einzel- und Gruppenberatung
- Beratung der Eltern
- Mediation/ Streitschlichtung
- Projekte und Angebote im Bereich Prävention
- Krisenintervention
- Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten
- Netzwerkarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
Neben diesen ordinären Angeboten ist die Toleranz- und Demokratieerziehung ein weiteres Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit. In den Arbeitsfeldern der Anti-Mobbing-Arbeit/ Mobbingprävention, bei Mediation, Klassenrat und dem Sozialen Lernen geht es auch darum, das friedliche Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen, Identitäten und kulturellen Lebensentwürfen zu ermöglichen und demokratisches Handeln einzuüben.
Jugendförderung/Projekt „Gewalt geht nicht!“ des Schwalm-Eder-Kreises
Die Arbeitsgruppe Jugendförderung/Jugendbildung beim Amt für Jugend und Familie des Schwalm-Eder-Kreises macht (Bildungs)Angebote für Kinder und Jugendliche bis 27 Jahren und führt in diesem Rahmen u.a. Seminare und Workshops mit dem Ziel durch, Identitätsentwicklung, Selbstbestimmung, Partizipation und gesellschaftliche Beteiligung zu ermöglichen.
Das Projekt „Gewalt geht nicht!“ ist auf Initiative des Kreises im Jahr 2008 gegründet worden und der Jugendförderung angegliedert. Das Projekt setzt sich für ein demokratisches, friedliches und tolerantes Miteinander ein und ist mit einem Förderbudget ausgestattet, mit dem andere Projekte aus Schule, Jugendarbeit, Vereinen und Verbänden gefördert werden können.
Darüber hinaus ist die Jugendförderung und das Projekt „Gewalt geht nicht!“ Koordinierungs- und Fachstelle im Bundesprogramm „Demokratie leben!“.
Die Entstehung und das Ziel
Von beiden Projektpartnern wurde die Projektidee, einen Methoden- und Modulkoffer für Schulen und Jugendarbeit zu entwickeln, in vielen gemeinsamen Arbeitstreffen vorangetrieben. Zur umfassenden Arbeit an diesem Projekt gehörten Planungstage, Workshops und Besprechungen ebenso wie die Projektpräsentationen im Begleitausschuss „Demokratie leben!“, um die notwendige finanzielle Förderung zu erhalten. Da die Entwicklungs- und Umsetzungsphase einen längeren Zeitraum in Anspruch nahm, war diese Zeit auch durch Fluktuation und Mitarbeiterwechsel geprägt. Insgesamt haben ca. 25 Mitarbeiter*innen am vorliegenden Methodenkoffer mitgewirkt. Uns war es immer wichtig, gemeinsame Entscheidungen zu treffen, möglichst im Konsens. So hat sich das Projekt auch anders entwickelt als zunächst gedacht. Aus einem (Politik)Parcours wurde gemeinsam die Idee der Box und der begleitenden Website entwickelt. Damit wollten wir einerseits ein Angebot für das Auge, zum Anfassen und (Be)Greifen schaffen andererseits eines, dass jederzeit erweiterbar, gut zugänglich und nutzbar ist.
Die Übungen, Spiele und Materialien decken inhaltlich verschiedene Bereiche und Kategorien ab, die je nach Einsatzzweck genutzt werden können:
Warming Up– und Cool Down-Spiele, Reflexions-, Vertrauens und Wahrnehmungsübungen, Übungen zur Demokratie und Toleranzförderung und zur Kooperation/Teambildung sowie Spiele zur Gruppeneinteilung.
Wir haben dabei folgende Ziele verfolgt:
- Spielerisches Lernen ermöglichen; Übungen zum Erleben und Mitmachen mit Workshopcharakter; Schüler*innen einbeziehen – kein Frontalunterricht.
- Durch Rollenwechsel Empathie ermöglichen.
- Einzeln abrufbare Bausteine anbieten, leicht zu verstehen und umsetzbar; zum Gestalten einzelner Unterrichtsstunden oder kompletter Projekttage – flexibel nutzbar.
- Jahrgangs- und schulformübergreifende Materialsammlung zur Verfügung stellen.
- Gemeinsame Materialien erstellen, auf die man Zugriff hat – nicht jede/r muss mit eigenen Materialien arbeiten, man kann voneinander profitieren – Synergieeffekte nutzen.
- Materialien erstellen, die für alle zugänglich und mehrjährig nutzbar sind.
Wichtig ist für uns vor allem eines: Die Toleranzbox soll genutzt werden. Sie soll an den Schulen im SEK bekannt werden – ihr Name ein Begriff. Zu den Aufgaben von uns, den Projektentwickler*innen gehört es, ihren Bekanntheitsgrad zu vergrößern, für ihre Nutzung zu werben, sie attraktiv zu halten und immer wieder Materialien zu aktualisieren und zu verbessern. Einher geht damit auch der Aufruf an Interessierte, Unterstützer und Nutzer*innen: Meldet euch bei uns und füttert die Toleranzbox mit guten Ideen und tollen Übungen. Die Box soll sich weiterentwickeln – die Box soll leben!
Das Shaka-Zeichen, dass in unserem Logo auftaucht – eine Faust mit abgespreiztem Daumen und kleinem Finger – ist als Gruß in der Surferszene und auf Hawai bekannt und steht für ein entspanntes Lebensgefühl nach dem Motto „immer locker bleiben“. Wir finden es auch Aussagekräftig für die Toleranzbox und möchten es bei der Auseinandersetzung mit dem Thema und dem spielerischen (aber auch ernsthaften) Durchführen der Übungen immer mitdenken.
Das Projekt wurde durch Mittel des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ gefördert. Wir danken dem Begleitausschuss für die Unterstützung und Begleitung unseres Projekts. Und ein Dank gilt auch Jonas Seemann von ahoidesign für die technische und gestalterische Umsetzung und sein Mitdenken im Entstehungsprozess.
i.A. Ulf Schlotthauer und Tom Werner, im Juni 2019
Toleranz – 10 Orientierungspunkte
Für die Auseinandersetzung mit dem Thema Toleranz und Intoleranz sind aus unserer Sicht die folgenden 10 Orientierungspunkte nützlich, die in der Zeitschrift „Politik und Unterricht“ – HEFT 1 – 2016, 1. QUARTAL, 42. Jahrgang im Aufsatz „Toleranz lernen – Zur Auseinandersetzung mit Toleranz und Intoleranz“ von Günther Gugel und Amos Heuss veröffentlicht wurden.
- Die pädagogische Haltung und das eigene Menschenbild als Grundlage betrachten
Toleranz ist Teil einer professionellen Haltung, die auf einem Menschenbild beruht, das dem Humanismus verpflichtet ist.
Sich des eigenen Menschenbildes und seiner Bedeutung zu vergewissern ist wichtig, denn es ist eine zentrale Grundlage des eigenen Handelns.
Das humanistische Menschenbild geht von der Gleichheit und Gleichwertigkeit aller Menschen aus:
- Menschen sind einzigartig und wertvoll.
- Soziales Lernen geschieht unbewusst über Modelle und Identifikationen.
Vorbilder spielen dabei als Identifikationsfiguren eine wichtige Rolle. »Erziehung heißt Vorbild« lautet deshalb auch ein Kernsatz des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen.
Ein Vorbild ist ein Beispiel, ein Leitbild, nach dem sich andere Menschen in ihrem Denken, ihren Wertungen und ihren Taten richten. Vorbildlichkeit kann sich auf den ganzen Menschen, jedoch häufiger auf spezifische Eigenschaften oder Fähigkeiten eines Menschen beziehen.
Tolerante oder intolerante Erwachsene und immer auch Vorbilder für Kinder und Jugendliche, denn diese richten ihr eigenes Verhalten auch nach dem Handeln Erwachsener aus.
- Soziale Wahrnehmung überprüfen
Menschliches Verhalten wird wesentlich durch die Wahrnehmung bestimmt. Dass und wie ein Mensch sich verhält, hängt davon ab, wie er die ihn umgebende Welt wahrnimmt, z. B. als bedrohlich, als fürsorglich oder als ungerecht.
Fehlwahrnehmungen, eingeschränkte Wahrnehmungen oder verzerrte Interpretationen und Verarbeitungen des Wahrgenommenen können unangemessene Reaktionen zur Folge haben. Dies wirkt sich auch auf Toleranz aus. Werden eine Person, eine Frage oder ein Problem als Bedrohung für die eigenen Überzeugungen oder Lebensweisen wahrgenommen, so wird eher mit Gegenwehr denn mit Toleranz reagiert.
- Sich selbst kennen und anerkennen lernen
Der Weg zur Toleranz beginnt bei ich selbst, beim Kennenlernen der eigenen toleranten und intoleranten Seiten.
Die Besonderheit des Jugendalters liegt in den vielfältigen Veränderungen und Umbrüchen, die sich in kurzer Zeit vollziehen. Wandel ist das eigentliche Merkmal und Thema des Jugendalters. Sich diesen Veränderungen zu stellen und mit ihnen produktiv umzugehen, ist eine der größten Herausforderungen – auch dafür, Toleranz zu lernen.
Toleranz und Akzeptanz anderer kann nur jemand lernen und leben, der selbst Toleranz und Akzeptanz gegenüber den eigenen Eigenarten erlebt hat, und vor allem jemand, der sich selbst mit seinen (scheinbaren oder tatsächlichen) »Defiziten« und »Mängeln« annimmt und auch seine eigenen Fähigkeiten und Stärken sehen und leben kann.
- Gute Kommunikation ermöglichen
Toleranz im Alltag bedeutet, miteinander in Kontakt zu kommen, sich wahrzunehmen und zu kommunizieren. Eine gelingende Kommunikation trägt wesentlich zur Toleranz bei. Es geht dabei nicht nur um Verstehen und Verstanden werden, sondern immer auch um Differenz und Abgrenzung sowie um die Klärung zwischenmenschlicher Beziehungen.
Kommunikation geschieht nicht nur verbal. Nonverbale Kommunikation ist direkter und aussagekräftiger als verbale. Sie richtig zu entschlüsseln und für den eigenen Ausdruck einzusetzen, ist für einen gelingenden zwischenmenschlichen Umgang äußerst hilfreich.
- Gefühle einbeziehen – Empathie entwickeln
Gefühle beeinflussen unser Verhalten. Positive Gefühle wirken sich unmittelbar auf unsere Bereitschaft aus, anderen zuzuhören, ihnen etwas zu gewähren, ihnen zu helfen oder tolerant zu sein. Die Fähigkeit zur Empathie ermöglicht es, sich intuitiv in den anderen hineinzuversetzen und mitzufühlen.
Auch negative Gefühle wirken sich auf das Verhalten aus. Vorurteile oder Abwertungen sind nicht nur »Meinungen« über andere, sondern immer auch in der Gefühlswelt verankert. Sie lassen sich deshalb nicht allein mit kognitiven Ansätzen bearbeiten. Wichtig für Erziehung und Bildung ist es zu berücksichtigen, dass negative Gefühle (insbesondere Angst) Lernprozesse erschweren oder ganz verhindern. Es gibt keine emotionsfreie oder neutrale Informationsverarbeitung.
Tolerant zu sein erfordert, eigene Entscheidungen zu treffen und eigene Meinungen und Überzeugungen zu hinterfragen. Dies auszuhalten bedarf einer gewissen Ich-Stärke. Diese zu entwickeln bzw. zu fördern kann deshalb als langfristige Aufgabe von Toleranz lernen angesehen werden.
- Mit Konflikten konstruktiv umgehen
Toleranz ist wichtig, um die Eskalation von Konflikten zu vermeiden. Sie trägt dazu bei, zu guten Lösungen zu kommen. Allerdings sollte Toleranz nicht dazu führen, bestehende Konflikte nicht aufzugreifen, denn Konflikte haben wichtige soziale Funktionen.
Sie machen auf Bedürfnisse aufmerksam, eigen, wo Probleme zu lösen sind, und sie helfen, durch gute Lösungen das Zusammenleben fairer zu gestalten.
Toleranz hilft, eine gewaltfreie, konstruktive Konfliktaustragung zu ermöglichen, die die Grundbedingung gelingenden menschlichen Zusammenlebens ist. Die Ermöglichung, Unterstützung und Förderung von konstruktiver Konfliktbearbeitung auf persönlicher, institutioneller und gesellschaftlicher Ebene bedeutet deshalb, alternative Handlungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen, die auf gegenseitiger Toleranz, Wertschätzung und Respekt beruhen und einen fairen Interessenausgleich anstreben.
Kommunikation und Respekt bedeutet …
- die Gebote der Höflichkeit beachten (Begrüßung, Verabschiedung);
- Wissen um die Subjektivität der eigenen Sichtweisen;
- ausreden lassen und einander zuhören;
- sensibel mit Bezeichnungen und Begriffen umgehen;
- den anderen nicht beschuldigen oder beleidigen;
- Anerkennung, Wertschätzung und das Bemühen um ein Verstehen des Gegenübers;
- diskriminierende, sexistische oder gewaltförmige Ausdrücke vermeiden;
- eine offene Haltung einnehmen.
- Teilhabe und Mitbestimmung erfahren
»Wenn Kinder und Jugendliche die Erfahrung machen, dass in Schule und Erziehung Mitwirkung, demokratisches Handeln und Verantwortungsübernahme erwünscht sind und als wichtig anerkannt werden, sind sie für Gewalt und Rechtsextremismus weniger anfällig als Jugendliche, denen diese Erfahrung versagt bleibt« (Edelstein/Fauser 2001, S. 20).
Demokratisch strukturierte Schulen, die ein hohes Maß an Mitgestaltung und Mitbestimmung aufweisen, sind nicht nur gewaltärmer, sondern zeigen auch eine höhere Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler. Denn hier sind die sozialmoralischen Voraussetzungen für Schulleben und Schulunterricht stärker entwickelt und die entsprechenden Selbst- und Sozialkompetenzen intensiver ausgebildet.
Demokratiepädagogik, verbunden mit mehr Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Eltern an Schulen, geht über die bislang verbrieften Beteiligungsrechte (Schulkonferenz, Schülervertretung, Elternvertretern) weit hinaus. Es geht nicht um die Erfüllung formaler Verfahren, sondern um die Partizipation aller Beteiligten. Möglichkeiten der Teilhabe und Mitbestimmung anzubieten und zu gewähren, betrifft in gleicher Weise auch Vereine und (Jugend-)Verbände.
Toleranz ist eine wichtige Bedingung gelingender Mitbestimmung, da es zu Sachfragen und Problemen zumeist unterschiedliche Ansichten, Überzeugungen und Lösungsvorschläge gibt. Die Suche nach einem gerechten Kompromiss kann nur gelingen, wenn alle Meinungen gleichberechtigt geäußert und toleriert werden können.
- Organisationsentwicklung und ein Schulethos fördern
Schule muss, wie jede andere Organisation auch, so gestaltet werden, dass sie tolerante Einstellungen und Verhaltensweisen fördert. Dies setzt die Entwicklung einer jugendorientierten Lernkultur und eines Sozialklimas voraus, die Ausgrenzung vermeiden, Anerkennung bieten und Jugendliche unterstützen. In der Praxis zeigt sich, dass es weniger um Einzelmaßnahmen geht – so wichtig sie auch sind – als vielmehr um die Herausbildung eines gemeinsamen Ethos (»Wir verhalten uns in unserem Verband, in unserer Schule so …«).
Auf die Wichtigkeit eines solchen Ethos weist auch die Organisationsentwicklungsforschung hin. Gerade bei sozialen Organisationen geht es nicht nur um Rationalität von Abläufen und Funktionalität von Strukturen, sondern eben immer auch um Sinngebung und Sinngestaltung, da diese auch eine geistig-kulturelle Dimension umfassen. Alle Bemühungen, die in diese Richtung gehen, leben letztlich von der Glaubwürdigkeit, der Überzeugungskraft und der Beziehungsfähigkeit aller Beteiligten, denn Kinder und Jugendliche brauchen glaubwürdige Vorbilder und Menschen, mit denen sie sich identifizieren können.
- Eine klare Werteorientierung vermitteln
Das Zusammenleben in einer Gesellschaft wird wesentlich durch drei Werte ermöglicht: Toleranz (verstanden als die Anerkennung des Anderen und seiner Andersartigkeit), Gerechtigkeit und Gewaltfreiheit. Auf den Wertebildungsprozess können Schule und Jugendarbeit auf zweierlei Weise einwirken: durch Geltend machen derjenigen Normen, die für die Aufgaben und den Erhalt ihrer Gemeinschaft unentbehrlich sind, und durch Reflexion einschlägiger Erfahrungen, insbesondere durch Konfliktlösungen (vgl. Gieseke 2005, S. 181).
Schule und Jugendarbeit sollten sich dabei als »gerechte Gemeinschaften« verstehen, in denen demokratische Teilhabe und fairer Umgang selbstverständlich sind. Dabei geht es nicht um Anpassung, sondern um Anerkennung von Differenzen und Toleranz.
- Toleranz ist nicht Beliebigkeit
In der öffentlichen Diskussion wird Toleranz immer wieder mit unterschiedlichen Argumenten kritisiert. Auf der einen Seite wird Toleranz mit Indifferenz und Beliebigkeit gesellschaftlicher Werte gleichgesetzt und für negative gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich gemacht, beispielsweise für das angebliche Scheitern der Integration von Einwanderern und ihren Nachkommen. »Multikulti ist gescheitert« soll beispielsweise auch heißen, jetzt ist Schluss mit Toleranz, weil das Tolerieren von scheinbar fremden Wertvorstellungen und Verhaltensweisen zur Unterdrückung der Frauen, zu Parallelgesellschaften, erhöhter Gewaltbereitschaft usw. führen würde. Auf der anderen Seite wird Toleranz als erstes Gebot einer übertriebenen Political Correctness dargestellt.
Menschen, die es wagen würden, öffentlich »die Wahrheit« über Minderheiten oder gesellschaftliche Missstände zu sagen, würden dem Vorwurf der Diskriminierung ausgesetzt und mundtot gemacht. Toleranz erscheint hier als eine Art »Gedankenpolizei«.
Toleranz ist jedoch weder beliebig noch repressiv. Sie ist eine der Grundlagen sozialer, kultureller und politischer Pluralität in modernen Gesellschaften und somit eine wichtige Voraussetzung von Demokratie. Als solche ist sie auch an weitere Grundwerte gebunden, wie sie beispielsweise in der Erklärung der Menschenrechte oder im Grundgesetz gewährt werden. Menschenwürde, Gewaltfreiheit oder Meinungsfreiheit werden durch Toleranz nicht relativiert, sondern bilden erst mit dieser gemeinsam ein tragfähiges Wertegerüst. Dennoch gibt es klare Grenzen der Toleranz, die bei der Verletzung der (Menschen-)Rechte anderer beginnen.